Personal: Beeing diagnosed with GBS (DE)
Für mich ist 2020 ein verrücktes Jahr. Nicht wegen der Corona Krise, sondern wegen der Autoimmunerkrankung Guillain-Barré-Syndrom (kurz GBS), welche im März diesen Jahres bei mir diagnostiziert worden ist. In diesem Blogartikel geht es (ausnahmsweise) nicht um Technik, sondern ich möchte hier über einen persönlichen Krankheitsverlauf berichten und wie es ist, zwei Monate ans Bett gefesselt zu sein. Gleichzeitig möchte ich Betroffenen und Angehörigen Mut machen, die mit einer GBS Diagnose selbst oder im Angehörigenkreis konfrontiert sind.
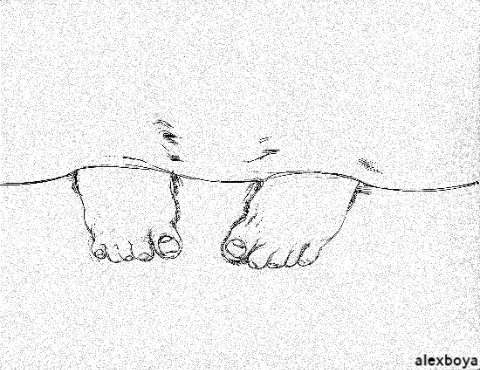
Kribbelgefühle, leider nicht im Bauch.
März 2020. Die Corona-Pandemie nimmt ihren Anfang und ich mittendrin. Kontakt zu anderen Personen vermeiden, Home Office machen, Zuhause bleiben, der eigentliche Traum eines jeden Technik-Nerds (ich mache nur Spaß) sollte endlich in Erfüllung gehen. Trotz Pandemie habe ich meine abendlichen Laufrunden beibehalten. Eines Abends nach dem Laufen merke ich, dass etwas mit meinen Füssen nicht stimmt. Ich habe ein seltsames Kribbelgefühl in Zehenspitzen, das auch am Abend auf dem Sofa nicht verschwinden will. Ich als Hobbymediziner google die Symptome natürlich, wissentlich, dass am Ende sowieso Krebs raus kommt. Egal. So schlimm kann es nicht sein denke ich mir. Am besten eine Nacht drüber schlafen, dann wird es bestimmt besser.
Am nächsten Tag ist dieses seltsame Gefühl immer noch vorhanden, schlimmer noch, es zieht sich entlang der Fußsohlen die Beine hoch. Immer noch das Kribbeln, jetzt kommt noch Taubheit hinzu. Am Abend merke ich, dass dieses merkwürdige Kribbeln sich ausbreitet bis zum Fussgelenk. Auch die Finger sind betroffen, zuerst der Kleine, dann der Ringfinger, dann die Handflächen. “Nun gut!”, denke ich mir, “Drüber schlafen, vielleicht wird es am nächsten morgen besser”. Im Liegen wird das Kribbelgefühl so unangenehm, dass ich die Bettdecke an meinen Zehenspitzen kaum noch wahrnehmen kann. Ich kriege kaum ein Auge zu und spüre, dass ich langsam die Kontrolle über meinen Körper verliere.
Am morgen danach kontaktiere ich meine Hausärztin und bekomme noch am selben Tag einen Termin. Ich fahre 20 Minuten nach Hamburg Langenhorn, steige die kleinen Stufen an der Eingangstür zur Praxis hinauf und bin ein wenig außer Atem. Beim Arztgespräch begutachtet sie mich, ich berichte von meinen Symptomen, sie untersucht mich und kommt zu dem Entschluss, dass es sich womöglich um einen akuten, neurologischen Notfall handelt. “Sie fahren besser ins Krankenhaus”, rät sie mir und bereitet die Überweisung vor. Freude und Beunruhigung teilen sich gleichermaßen mein Gemüt, zum Einen weil der Sache auf den Grund gegangen wird, zum Anderen wegen dem mir unbekannten Ernst der Lage. Ich folge dem Rat meiner Hausärztin und fahre in die Asklepios Klinik Nord nach Langenhorn in Hamburg, aber davor noch einmal nach Hause und Sachen packen für ein paar Tage Aufenthalt.
Daheim stopfe ich alles Notwendige in den Rucksack, bereit für einen Wochenendaufenthalt im Krankenhaus. Auf dem Weg dorthin stelle ich fest, dass ich mich nach kurzer Strecke zu Fuß erschöpft und müde fühle. Ein 26-Jähriger, schwere Beine, wackelig auf den Knien, außer Atem nach wenigen hundert Metern.
Auf der Suche nach den Ursachen.
Im Krankenhaus aufgenommen folgen schnell die ersten Diagnosen. Blutabnahme. EKG. Eine elektronische Untersuchung der Leitfähigkeit der Nervenfasern. Anschließend eine Lumbalpunktion bei der Nervenwasser aus dem Rücken auf Höhe der Lende entnommen wird. Reflexuntersuchungen und MRT. Ich bin den Ärzten sehr dankbar, denn mit Hochdruck wird versucht eine Ursache für meine Symptome zu finden. Nach kurzer Zeit gibt es eine erste Diagnose. Alles deutet auf das “Guillain Barré-Syndrom” hin attestieren die Ärzte. “Das klingt erstmal gar nicht so schlimm”, denke ich mir und bin froh, dass die ganze Sache nun endlich bei Namen genannt werden kann.
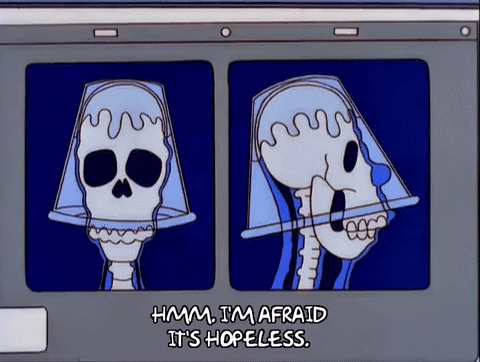
Das Syndrom, benannt nach zwei französischen Ärzten, die die Symptome erstmals 1916 schriftlich festgehalten, ist eine neurologische Erkrankung die auf einer Entmarkung von Nervenfasern beruht erzählt man mir. Hierbei verlieren die Nervenzellen ihre isolierende Schicht, vergleichbar mit einem Stromkabel, wodurch die Nervenzelle die Funktion zur Informationsweitergabe verliert. Äußern tut sich dieser Verlust durch Muskelschwäche in den Händen und Füßen, die dann aufsteigt. Die Ursache ist nicht geklärt, allerdings ist ein Erkrankungsgipfel um das 25. und 60. Lebensjahr erkennbar. Es werden eine Autoimmunreaktion und neuroallergische Reaktionen auf vorangegangene Infektionen vermutet, aber eindeutige Beweise gibt es nicht.
In Deutschland erkranken rund 1500 Menschen im Jahr an der seltenen Nervenkrankheit. Es gibt unterschiedliche Verlaufsformen der Erkrankung, von leichten Schwächegefühlen bis zur vollständigen Lähmung, wobei die Betroffenen noch bei vollem Bewusstsein sind. Es können auch die Hals- und Brustmuskeln versagen, was die Fähigkeit zum Atmen und Schlucken beeinflussen kann.
Ein Lottogewinn wäre mir lieber gewesen. “Die Prognose für Ihre Erkrankung ist gut, jedoch müssen sie sich auf einen längeren Aufenthalt einstellen. Die Symptome können sich verschlechtern und die Erholung Wochen, Monate bis Jahre dauern”, erläutern mir die Ärzte. Eine Diagnose, mit der ich nicht gerechnet habe.
Mein Körper greift sich an.
Kurz nach der Diagnose erhalte ich fünf Tage lang sogenannte Immunglobuline, Antikörper die mein fehlgeleitetes Immunsystem daran hindern sollen, weiter mein eigenes Nervensystem zu attackieren. Trotzdem merke, wie ich mich täglich schwächer fühle. Am ersten Tag der Behandlung merke ich, dass es mir schwer faellt aus dem Krankenbett in das Badezimmer zu laufen. Beim Duschen bekomme ich kaum die Arme gehoben. Nach wenigen Metern bin ich erschöpft wie nach einer Joggingrunde. Am Tag darauf kann ich kaum mehr frei durch das Zimmer laufen, muss mich an den Wänden festhalten um nicht hinzufallen. Ich merke wie die Kraft schwindet und bin beim Abendbrot kaum mehr in der Lage Löffel und Gabel zu halten. Am Morgen schaffe ich es nicht mehr selbstständig das Frühstück zu essen, selbst ein belegtes Brötchen kriege ich nicht gehoben. Innerhalb kürzester Zeit kann ich nicht mehr aus dem Bett aufstehen, nicht mal aus eigener Kraft an die Bettkante setzen. Meine Augen schließen nicht mehr, die Lippen werden starr und ich verliere den Geschmackssinn. Meine Finger klappen ein und mir fehlt die Kraft mich im Bett zu drehen und die Decke oder das Kopfkissen auch nur einen Zentimeter zu bewegen.
Innerhalb weniger Tage bin ich ein Gefangener im eigenen Körper. Ich habe die Kontrolle über die wichtigsten Muskeln verloren. Alles was mir an Bewegung bleibt ist der Kopf, den ich ein wenig hin und her bewegen kann und meine Arme, die ich ein paar Zentimeter vom Bettlaken heben kann. Dinge die vorher selbstverständlich waren sind nun ein Ding der Unmöglichkeit. Mein Kopf arbeitet, ich bekomme ein wenig Panik. Panik, weil ich nicht mit dieser Entwicklung gerechnet habe. Die Pflegerinnen und Pfleger kümmern sich liebevoll um mich. Physiotherapeuten bewegen meine Gliedmaßen, dehnen Füße und Hände. Sie bekämpfen meine Nacken- und Rückenschmerzen, die durch das lange Liegen entstanden sind.
Weil die Behandlung nicht anschlägt, werde ich nach Hamburg Barmbek zur weiteren Therapie auf die Stroke Unit verlegt. Ich erhalte eine sogenannte Plasmapherese oder auch Blutwäsche genannt über 14 Tage mit 6 Sitzungen. Hierbei wird versucht, die schädlichen Antikörper aus meinem Blut herauszufiltern. Die Ärzte kommen täglich und erkundigen sich nach meinem Zustand.
Die Zeit vergeht sehr langsam. Besonders an den Wochenenden und Feiertagen, an denen keine Behandlungen und Visiten durchgeführt werden. Während der Corona-Krise sind Patientenbesuche im Krankenhaus verboten, weshalb mich meine Familie und Freunde nicht besuchen können. Einen Fernseher im Zimmer gibt es nicht. Ich lerne die kleinen Dinge im Leben zu Schätzen und freue mich jedes mal, wenn jemand das Zimmer betritt und sich wenn auch nur ein paar Minuten mit mir unterhält. Um ein Buch zu halten und zu lesen bin ich zu schwach, selbst mein Handy kann ich nicht bedienen, da ich die Finger nicht bewegen kann.
Ich komme ins Grübeln und mache mir Gedanken. Wie geht es weiter mit meiner Arbeit? Werde ich meinen Abschluss machen können? Wie werde ich zukünftig meinen Alltag bewältigen, wenn Restsymptome verbleiben? Stunden und Stunden vergehen.

Die schönste Ablenkung ist das Telefonieren. Das Schwierige hierbei ist nur, dass ich selbst keine Anrufe entgegennehmen oder tätigen kann. Ich bitte die Pflegekräfte eine Nummer zu wählen und sie legen das Telefon neben meinen Kopf auf das Kopfkissen. Ich telefoniere viel mit Freunden und täglich mit meiner Familie. Jedes Gespräch gibt mir Mut und Hoffnung, die ich merklich täglich brauche. Sie erzählen mir was “draußen” passiert. Von der Corona-Krise merke ich im Krankenhaus nichts. Täglich kommen Physio- und Ergotherapeuten zu mir, um meinen stark abgebauten Muskeln ein paar Impulse zu geben. Ich werde einmal am Tag an die Bettkante gesetzt, was sich wegen der Muskelverkürzung durch das viele Liegen vor Schmerzen wie ein Spagat anfühlt. Von zwei Therapeuten gestützt, werde ich auf meine Beine gestellt. Auch das halte ich nur wenige Sekunden durch, bis mir vor Schmerzen und Anstrengung der Schweiß von der Stirn läuft.
Nach den ersten Plasmapherese-Sitzungen merke ich eine leichte Verbesserung. Ich kann die Finger minimal öffnen und meinen Arm auf den Oberschenkel legen. Auch die Beine kann ich im Bett wenige Zentimeter anstellen. Kurz darauf merke ich jedoch, wie die Schwäche meine Beine hoch schleicht. “Das ist ein ungewöhnlicher Verlauf bei Ihnen”, attestieren mir die Ärzte. Eine Aussage, die mir nicht unbedingt Mut macht. Ich atme flacher und merke Abends, dass ich meinen Kopf kaum vom Kissen heben kann. Meine Lippen fühlen sich betäubt an und das Sprechen ist kaum möglich. Beim Abendbrot brauche ich eine Stunde, um ein belegtes Schwarzbrot zu zerkauen. Die Ärzte untersuchen mein Lungenvolumen, welches nur noch knapp zu 30% dem eines gesunden Menschen entspricht. Für die nächsten Tage werde ich sicherheitshalber auf die Intensivstation verlegt, da die Lähmungen sich auf lebenswichtige Organe wie das Herz und die Lunge ausdehnen können. Ich schlafe sehr schlecht, denn die Geräuschkulisse der Medizingeräte, Kabel und schläuche an meinem Körper tragen nicht unbedingt zum Komfortfaktor bei. Meine Hoffnung, dass alles wieder so wird wie es mal war schwindet mit jeder Stunde. Jedoch geben mir meine Familie bei Telefongesprächen und die Pflegekräfte vor Ort viel benötigte Kraft.
Weil mein Krankheitsverlauf ungewöhnlich sei und das Fortschreiten der Lähmungen gestoppt werden muss, erhalte ich weitere Plasmapherese-Sitzungen und eine Kortisonstoßtherapie. Nach einigen Tagen folgt erneut eine Verbesserung meines Zustandes. Ich kann die Lippen wieder bewegen und meinen Kopf vom Kissen heben. Auch die Arme bekomme ich auf meinen Oberschenkel gelegt. Alle fünf Finger meinen linken und rechten Hand bekomme ich geöffnet, allerdings reicht es noch nicht um Dinge zu heben oder zu bedienen. Auch die Beine kann ich wieder anziehen, aber es reicht noch nicht um mich aus eigener Kraft im Bett zu drehen. Das müssen nach wie vor die Pflegekräfte alle drei Stunden machen. Mit der Freude über die Besserung bin ich noch zurückhaltend, weil die letzten Male gezeigt haben, dass die Erkrankung noch nicht überstanden sein könnte.
Im Bett trainiere ich täglich meine kleine zurückgewonnene Bewegungskraft. Ich knete wechselseitig einen zusammengerollten Verband in der Hand und bekomme ein Bettfahrrad, mit dem ich meine Beinmuskulatur trainiere, die nach Wochen des Liegens nur noch aus Knochen bestehen. Nach wie vor übe ich mit den Therapeuten das Sitzen an der Bettkante und das Stehen auf den eigenen Beinen. “Ich würde mal schätzen, dass du mindestens sechs Monate brauchst um wieder ganz normal Gehen zu können nach deiner Bettlägerigkeit”, prophezeit mir mein Physiotherapeut. Was zunächst demotivierend klingt, spornt mich an. Ich möchte, dass wieder alles so wird wie vorher, ohne Einschränkungen. Täglich dehne ich mich morgens, mittags und Abends im Bett und versuche die Trainingszeiten zu verlängern. Ich merke, wie jeden Tag ein bisschen was von meiner Kraft zurückkommt. Wenn auch nur in Ameisenschritten. Aber selbst diese kleinen Schritte motivieren mich, weiter zu machen und geben mir Mut. Auch der positive Zuspruch der Therapeuten motiviert mich sehr, weiter an mir zu arbeiten.
Langsam beginnen die grauen Wolken der letzten Wochen zu verschwinden und ich werde täglich zuversichtlicher. Mittlerweile ist es Mai, fast Sommer. Ich werde von der Intensivstation wieder verlegt auf die Beobachtungsstation im Erdgeschoss des Krankenhausgebäudes. Durch die Fensterscheibe meines Krankenzimmers bemerke ich, dass die Bäume mittlerweile saftige, grüne Blätter haben. Den März und April habe ich nur vom Bett aus mitbekommen. Nach Wochen sehe ich meine Eltern wieder. In das Krankenhaus können sie leider nicht, aber das sie mehrmals die Woche zu mir vor das Zimmerfenster kommen können und wir ein paar Worte wechseln ist für mich schon das größte Glück dieser Welt. Sie einfach Winken und Lachen zu sehen macht mich froh. Auch Pizza bekomme ich ins Krankenhaus geliefert von Freunden. Ich hatte schon vergessen, wie gut so eine Pizza schmecken kann! Mit meinen Fingern kann ich wieder langsam das Touchdisplay meines Smartphones bedienen. Wieder Artikel zu lesen, im Internet zu surfen, mitzubekommen was sich in der Uni getan hat, jede Kleinigkeit der wiedergewonnenen Freiheit fühlt sich einfach großartig an.
Es geht bergauf!
Mitte Mai werde ich zurück in das Heidberg Krankenhaus in Hamburg, Langenhorn verlegt, in die neurologische Frühreha. Insgesamt acht Wochen sind vergangen, seit ich mit Kribbelgefühlen in den Füßen ins Krankenhaus gekommen bin. Acht Wochen, in denen ich nicht aus dem Bett aufstehen konnte. Insgesamt habe ich 18kg abgenommen, das meiste davon Muskelmasse.

In Millimeterschritten geht es voran. Mehrmals täglich habe ich Trainingstherapien. Ich fühle mich wie ein Kind, das alles neu lernen muss. “Wird alles wieder so wie es mal war?”, frage ich die Ärzte gefühlt bei jeder Visite. Immer wieder die Antwort: “Ja, aber Sie brauchen Geduld, sehr, sehr viel Geduld”. “Stellen Sie sich vor wie schlapp Sie sich nach einer Woche Erkältung im Bett fühlen und wieder mit Sport anfangen”, wird mir gesagt, “Sie waren acht Wochen im Bett, das braucht Zeit!”. Geduld, die ich nicht habe aber Lernen muss. Ich erhalte weiterhin Kortison und Immunsuppressiva, die mich bis heute begleiten. Das Schlimmste ist überstanden.
Die Therapeuten und Pfleger geben sich grosse Muehe und motivieren mich täglich bei den gnadenlos anstrengenden Sporteinheiten. In den nächsten fünf Wochen erobere ich mir in kleinen Schritten mein Leben zurück. Ich lerne, wie ich mich selber ohne Hilfe an die Bettkante setzen kann. Ich lerne das Greifen, Besteck zu halten, mir selbst die Zähne zu putzen, mich morgens und Abends selbst zu waschen und mich anzuziehen. Für gesunde Menschen scheinbar Kleinigkeiten, die für mich die letzten Wochen unmöglich waren. Ich trainiere meine Feinmotorik mit Knetübungen und Sortieraufgaben und schreibe Tagebuch über meinen Krankheitsverlauf. Zittrig halte ich den Stift und kritzel auf den ersten Seiten unleserliche Wörter auf das Papier. Aber täglich wird es besser.
Die nächste große Hürde die ich nehme, ist das selbstständige Verlagern von der Bettkante in den Rollstuhl, in den ich zuvor nur mit Hilfe von Pflegern gelangt bin. Das nächste Highlight lässt nicht lange auf sich warten. Der erste Ausflug in die Sommersonne. Ich habe ganz vergessen wie sich die warmen Sonnenstrahlen und die leichte Brise auf der Haut anfühlen. Ich geniesse jede Sekunde die ich draußen sitze und das Rascheln der Blätter im Wind höre. Mittlerweile ist auch unter Auflagen wieder Besuch im Krankenhaus erlaubt. Nach Wochen sehe ich Freunde und Familie wieder. Nicht nur durch die Glasscheibe des Zimmerfensters, sondern als richtigen Krankenhausbesuch. Von der zurück erlangten Freiheit inspiriert, schiebe ich mich täglich im Rollstuhl den Krankenhausflur entlang. Jeden Tag ein Stückchen weiter. Mit Hanteln mache ich Gewichtsübungen im Zimmer und führe nach wie vor eisern meine Dehnübungen durch. Ich war nie gelenkig, was das ganze nicht einfacher macht.
Ich lerne das Laufen. Gestützt von Therapeuten lerne ich zunächst am Reck, schaffe 5 Meter vor und zurück, ehe ich vor Erschöpfung wieder in den Rollstuhl sinke. Jeden Tag geht es besser. Es folgt das Loslassen der Hände, die dennoch über den Stützbalken schweben. Am Rollator laufe ich den Flur entlang. Einen Tag hin. Am anderen hin und zurück. Die Therapeuten sagen ich mache große Fortschritte. Mehrmals täglich übe ich das selbstständige Aufstehen aus dem Rollstuhl am Geländer im Krankenhausflur.
Mir wird der Rollstuhl weggenommen. Nun heisst es nur noch am Rollator gehen. Jeder Schritt ist nach wie vor schwer wie Blei. Die vielen Meter im Rollstuhl, die ich mich vorher bewegen konnte, muss ich nun wieder zurückerobern. Doch die Beine werden jeden Tag leichter, wenn auch sehr langsam. Ich lerne das Treppensteigen. Ein wenige Zentimeter hoher Balken im Behandlungsraum gleicht anfangs einer Mount Everest Besteigung. Täglich üben wir, mit jedem Tag wird klappt es besser und wir üben an nach kurzer Zeit an richtigen Treppenstufen. Mit einer Hand am Treppengeländer, mit der anderen an der meiner Therapeutin, kriege ich das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht, als ich nach vielen Tagen des Trainings selbstständig den ersten Stock Treppenhauses der Klinik erklimme.
Jeden Abend mache ich eine kleine Spazierrunde am Rollator durch den Innenhof auf dem Krankenhausgelände. Jeder noch so kleine Gang trägt dazu bei, dass ich am Folgetag wieder ein paar Meter mehr schaffe. Meine Beine sehen langsam wieder aus wie Beine, und ich merke täglich, dass mein Gang sicherer wird. Er ist zwar noch schlurfen und langsam und die Schwere in den Beinen hängt nach wie vor an mir wie eine Klette, aber zumindest tragen sie mich wieder von einem Ort zum Anderen nach so langer Zeit. Im Zimmer übe ich das freie Gehen ohne Hilfsmittel. Ich versuche wenige Meter vom Fenster aus bis zu meinem Bett zu gehen, immer und immer wieder, um mein Gleichgewicht wieder zu erlangen. Auf langen Strecken hangel ich mich nach wie vor noch unsicher an der Wand entlang, jedoch gewinne ich täglich mehr Vertrauen in meinen Körper zurück.
Mitte Juni werde ich in das RehaCentrum Hamburg am Universitätsklinikum Eppendorf verlegt. Hier beginnt die die nächste Trainingsphase. Ich erhalte täglich Ausdauertraining auf dem Laufband und Krafttraining an Geräten. In den ersten Tagen fühlt sich alles wackelig an und mir fällt es schwer mich selbständig in die Geräte zu setzen. Täglich merke ich aber dass es besser wird. Vor allem in den Beinen kommt die Kraft zurück. Wo ich vor wenigen Wochen nur 5 Kilo mit beiden Beinen bewegen konnte, Ich bin mittlerweile wieder in der Lage 30 kg zu stemmen. Alles weit entfernt von der Normalität aber ein enormer Sprung im Vergleich zu den letzten Wochen. Ich bin motiviert weiterzumachen und meine Muskeln zu trainieren. Obwohl ich eigentlich das Krankenhausgelände nicht verlassen darf, gehe ich einen Kilometer weiter ins Stadtzentrum von Eppendorf um mir nach Monaten mal wieder die Haare schneiden zu lassen beim Friseur. Für diesen einen Kilometer brauche ich sehr lange und muss mich zwischenzeitlich viermal hinsetzen und an eine Hauswand anlehnen um meine Beine auszuruhen. Aber es funktioniert: sie tragen mich wieder. Schwer fallen mir nach wie vor die Bodenübungen auf der Matte. Ich komme kaum vom Boden wieder zurück in den Stand, besonders das Aufstehen aus der Hocke ist sehr schwierig da ich noch Gleichgewichtsprobleme habe. Mit meiner Therapeutin arbeite ich täglich und sie gibt mir Tipps wie ich die Übungen korrekt ausführen kann.
Wochen vergehen und ich bin wieder in der Lage in normaler Geschwindigkeit zu gehen. Neben dem Rehazentrum befindet sich ein großer, weitläufiger Park der gerne zum Joggen genutzt wird. An sonnigen Tagen übe ich hier mit meiner Therapeutin das Laufen. Zu Beginn schaffe ich zwar nur wenige Meter, aber täglich kommt die Ausdauer zurück und die zurückgelegte Strecke länger.
Im Park gehe ich oft mit Freunden spazieren die mich besuchen kommen. Die Besuche sind immer das schönste am ganzen Tag. Es ist einfach wunderbar wieder ein Stück Normalität zu haben, über die alltäglichen Dinge zu quatschen und das Gefühl zu haben wieder am Alltag teilzunehmen. In Eppendorf gehe ich auch täglich einen Espresso trinken, ein kleines Ritual was ich mir angeeignet habe.
Am 24. Juli werde ich aus der Reha entlassen. Nach 122 Tagen Krankenhaus und darauffolgender Rehabilitation komme ich endlich wieder nach Hause. Das Gefühl wieder durch die eigene Haustür zu gehen ist unbeschreiblich nach so langer Zeit. Nie zuvor war ich so glücklich wieder daheim zu sein. Die erste Nacht wieder im eigenen Bett zu schlafen und morgens aufzuwachen ohne dass eine Pflegekraft das Frühstück ins Zimmer bringt oder ein Therapeut zum Termin ruft, ist nicht in Worte zu fassen.
Was verbleibt?
Diesen Blogartikel schreibe ich nun Ende September diesen Jahres, also knapp zwei Monate nach Entlassung aus der Rehabilitation. Mittlerweile ist die Normalität größtenteils wieder zurückgekehrt. Ich habe auch wieder angefangen zu arbeiten, coronabedingt erstmal nur im Homeoffice. Ich habe mein Studium wieder aufgenommen und mache mir Gedanken über ein Thema für meine Masterarbeit. Ich fahre wieder mit Bus und Bahn in die Stadt, fahre Auto, ziehe mich alleine an und habe keine Einschränkungen im Alltag.
An meiner Ausdauer muss ich nach wie vor arbeiten. Zum Beispiel fällt mir das Joggen und Treppensteigen nach wie vor etwas schwer. Zu Hause mache ich regelmäßig Mattenübungen, die mir sehr helfen. Ein paar wenige Restsymptome wie Missempfindungen in den Fußsohlen und in den Zehenspitzen sind nach wie vor vorhanden, ebenso wie ein leichtes Zittern in den Händen, das wie eine Narbe an die schwere Krankheit vor ein paar Wochen erinnert. Alles Langzeitfolgen, mit denen ich leben kann und die mich nicht einschränken.
Ein neues Leben.
Die Frage was den Nerven Kurzschluss bei mir ausgelöst hat ist nach wie vor ungeklärt. Manchmal rätsele ich ob es an meinem Lebensstil lag. Ich habe nicht ungesund gelebt, habe ab und an Sport getrieben und mich regelmässig bewegt. Ich bin Nichtraucher, getrunken habe ich auch nicht. Höchstens etwas zu viel Kaffee ab und an. Wenn ich wüsste woran es gelegen hat, könnte ich es ändern. Allerdings wird die Frage nach der Ursache wohl für immer ungeklärt bleiben. Eine Antwort auf diese Frage zu finden ist mittlerweile für mich auch nicht mehr wichtig. Mir geht es wieder gut und ich habe Glück gehabt.
Am 23. August diesen Jahres habe ich nun offiziell den ersten Geburtstag meines neuen Lebens gefeiert. Ein neues Leben, dass ich “dank” der Erkrankung deutlich bewusster führe.
Heute kann ich sagen, ich habe die Krankheit besiegt. Die Ärzte, die im März diesen Jahres die Diagnose gestellt hatten mit der Aussage, dass die Prognose bei GBS trotz des schweren Verlaufs gut sei, haben recht behalten.
Er sagt sich immer leicht, aber GBS ist eine der Erkrankungen bei denen es gilt die Hoffnung nicht verlieren! Das Erschreckende bei der Erkrankung ist der lange Zeitraum, über die sie sich erstreckt. Ich hatte sehr viel Zeit zum Nachdenken und es lässt sich nicht vermeiden, dass man ins Grübeln gerät und das Licht am Ende des Tunnels aus den Augen verliert. Besonders geholfen haben mir die Telefonate und Besuche von meiner Familie, meinen Verwandten und meinen Freunden und der wochenlange Einsatz der Ärzte, Pflegekräfte und Therapeuten die trotz der stressigen Pandemiezeit im Krankenhaus mir sehr viel Kraft und Mut gegeben haben. Ich habe gelernt Hilfe zuzulassen, sowohl seelisch als auch physisch und habe ein großes Glück, viele liebe Menschen um mich herum zu haben, ohne deren Beistand ich die Erkrankung nicht so gut bewältigt hätte. An dem kitschigen Spruch “Liebe kann Berge versetzen” ist tatsächlich etwas dran. Das kann ich nun bestätigen.
Einer meiner Therapeutin sagte zu mir: “Lass dich nicht unterkriegen, du bist der Chef über deinen Körper und nicht GBS!”. Er hat recht. Auch wenn die Krankheit einen selbst zunächst zurückwirft, ist es wichtig, an den eigenen Zielen festzuhalten und sie nicht aus den Augen zu verlieren oder sogar aufzugeben. Vielleicht brauche ich nun etwas länger sie zu erreichen oder ich muss den einen oder anderen Umweg gehen. Jedoch ist für mich am wichtigsten, dass ich mich von der Erkrankung nicht unterkriegen lasse und mit meinem Leben genau dort weitermache, wo ich zuletzt vor einigen Monaten aufgehört habe.
Morgens wenn ich aufstehe setze ich mich ein paar Sekunden an die Bettkante und schaue, ob auch an diesem Tag meine Beine mich wieder tragen können. Eine kleine Macke, die von dem langen Krankenhausaufenthalt übrig geblieben ist. Ich habe gelernt die kleinen Dinge im Leben mehr zu schätzen. Morgens aufzustehen und selber laufen zu können, mir selber einen Kaffee zu machen mir die Zähne zu putzen, mich anzuziehen und all die scheinbaren Kleinigkeiten, die viele Wochen nicht möglich und die jahrelang so selbstverständlich waren.
Ich möchte Danke sagen, an die vielen Menschen die mir in den letzten Monaten geholfen haben und sage zum Schluss nun einfach kurz und knapp: “Kann wieder losgehen!”
Euer Christian